|
Ab 1952 erfolgte der Zusammenschluss in LPGs. |
der Kommunistischen Partei Deutschlands im Jahre 1945. |
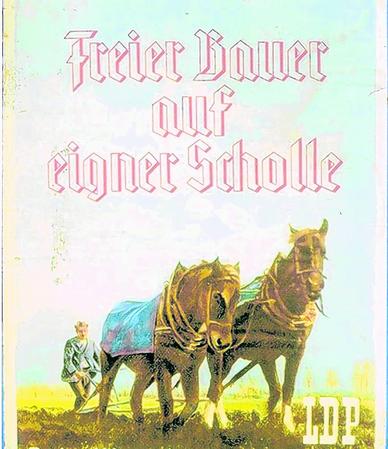 |
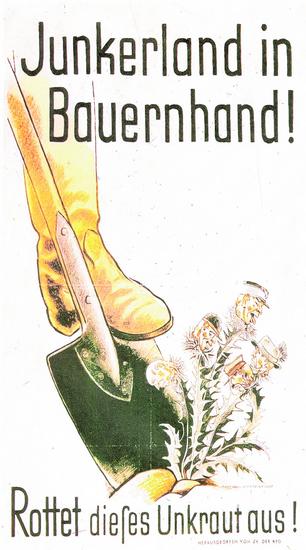 |
Die Vorgeschichte der Bodenreform
Reichssiedlungsgesetz von 1919 brachte keinen befriedigenden
Wandel
Die Bodenreform ist keine Erfindung des Jahres 1945. Reformbestrebungen
gibt es schon seit Jahrhunderten. Es geht immer um die Neuaufteilung des
Grundbesitzes, den besitzlosen Bürgern Land zu übergeben, um
ihre Existenz zu sichern, sie sesshaft zu machen und damit der Landflucht
entgegen zu wirken. So wurden durch die Französische Revolution 1789
alle Klöster enteignet. Die Nationalisierung des Bodens beschloss
die erste demokratisch gewählte Volksvertretung Russlands am 18. Januar
1918 einstimmig. Nach diesem Beschluss folgte das Gremium nicht dem kommunistischen
Programm der Bolschewiki und wurde darauf von Lenin auseinander gejagt.
In Deutschland bemühte man sich mit wechselndem Erfolg um eine Reform
des Bodenrechts. Weder die verschiedenen Siedlungsbewegungen - innere Kolonisation
ab 1886 - noch das Reichssiedlungsgesetz von 1919 auf Grundlage des Artikels
155 der Verfassung der Weimarer Republik brachten einen befriedigenden
Wandel. In Deutschland wurden so nur 124 000 Siedler- oder Bauernstellen
geschaffen. Bezeichnend ist, dass erst die Siegermächte des Zweiten
Weltkrieges mit dem Potsdamer Abkommen in allen Besatzungszonen eine Bodenreform
anordneten.
Ein Jubiläum im Zwielicht
Am 11. September 1945 wurde die Durchführung der Bodenreform verordnet
Am 11. September begingen wir den 65. Jahrestag der Bodenreform in
Sachsen. Ein Jubiläum im Zwielicht. Einerseits wurde durch diese Maßnahme
den Umsiedlern, landarmen Bauern und Siedlern Boden zur Verfügung
gestellt, damit der "Landhunger" gestillt. Die Umsiedler erhielten eine
Existenzgrundlage und den Siedlern wurde eine Basis zur Ernährungssicherung
ihrer Familie geschaffen. Zum anderen wurden die entschädigungslos
Enteigneten mit großer Brutalität behandelt, die sich in geistiger
und körperlicher Gewalt äußerte. Am oben genannten Tag
erließ die Landesverwaltung Sachsen die Verordnung über die
Durchführung der demokratischen Bodenreform.
Rückgang der Agrarproduktion
Durch den Befehl Nr. 110 der sowjetischen Militäradministration
(SMAD) vom 26. Oktober 1945 wurde das Gesetz rechtskräftig. Die Durchführung
der Bodenreform in der sowjetisch besetzten Zone war mit nicht zu rechtfertigenden
Gewaltakten gegenüber den Betroffenen begleitet. Man veränderte
die eigenen Gesetze willkürlich. Güter von Familienangehörigen
wurden zusammengerechnet, um die notwendigen 100 Hektar zu erreichen. Unbescholtene
Großbauern wurden durch Denunziation zu Naziaktivisten gemacht. Dies
geschah besonders in Gebieten mit wenigen Rittergütern, beispielsweise
im Altenburger Land. Ein bei Stalingrad gefallener Gefreiter erhielt den
Status eines Kriegsverbrechers und die Hinterbliebenen wurden enteignet.
Hitlergegnern aus Adelskreisen wurde keine Milde zu teil. Die Enteigneten
mussten sich auf Sammelstellen zwecks Abtransport auf die Insel Rügen
einfinden. Die Überführung von Zwangsarbeitern nach Sibirien
kann nicht belegt werden. Andere Großgrundbesitzer wurden des Kreises
verwiesen oder mussten sich mehr als zehn Kilometer entfernt von ihren
Gütern aufhalten. Letztlich zogen sich die meisten Betroffenen in
die Westzonen zurück. Mit der SPD spielte die KPD die Rolle des Vollstreckers
der Bodenreform, natürlich mit der Rückendeckung der SAMD und
der Roten Armee. Die Vertreter der neu gegründeten Parteien CDU und
LPD (später LDPD) bemühten sich leider erfolglos um eine menschlichere
Abwicklung der Reform. Sogar der Präsident der Provinz Sachsen - später
Sachsen-Anhalt - Prof. Dr. Hübener ging in Einspruch. Ihm lag die
Sicherung der Ernährung besonders am Herzen. Seine Bedenken erlangten
grausame Wirklichkeit, indem die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln
nach dem Rückgang der Agrarproduktion um 25 bis 30 Prozent, verschuldet
durch die Bodenreform, zusammenbrach. Hinzu kam noch eine extreme Witterung
in den Jahren 1946/47. Im Land herrschte eine Hungersnot. Auch in der KPD
gab es gemäßigte Kräfte. So sei es dem Spitzenfunktionär
Edwin Hoernle zu verdanken, dass die Enteignungsgrenze bei 100 Hektar verlief
und nicht - wie von den Sowjets eigentlich geplant - viel niedriger.Nach
der Wiedervereinigung blieb die Bodenreform entsprechend des Einigungsvertrages
bestehen. Beim Rückgängigmachen hätte man altes mit neuem
Unrecht bezahlen müssen. Aber die Nachkommen der Alteigentümer
wollten mit aller Macht eine Rückgabe ihres Eigentums erzwingen.
Vor Gericht gescheitert
Sie scheiterten 1991 vor dem Bundesverfassungsgericht und gingen nach
einer unverantwortlichen Äußerung von Gorbatschow noch einmal
nach Karlsruhe, um 1996 wiederum zu scheitern. Eine Kuriosität der
deutschen Rechtsgeschichte. Die heutige Situation ist, dass die Nachkommen
der Alteigentümer in einem gewissen Umfang entschädigt wurden
und einige den Besitz zurück kauften. Bodenreformlandbesitzer, die
vor 1990 mindestens zehn Jahre in der Landwirtschaft arbeiteten, behielten
das Land als uneingeschränkte Eigentümer. Im Gegensatz zu DDR-Zeiten
konnte es jetzt auch verkauft werden. Das Gleiche gilt auch für die
kleinen Parzellen der Siedler. Allen übrigen Grundbesitz übernahm
die Bodenverwertungs- und Verwaltungs GmbH (BVVG), die es weitgehend durch
Verkauf privatisiert hat.
| Entschädigungslos wurde der Grundbesitz enteignet von: | Nicht enteignet wurde der Grundbesitz von: |
| Kriegsverbrechern
Kriegsschuldigen Naziführern Großgrundbesitzern über 100 Hektar
|
Versuchsgütern
Lehranstalten Mustergütern Saatgutwirtschaften Tierzuchtbetrieben Städten und Schulen kirchlichen Einrichtungen |
Im Kreis Grimma wurden 70 Güter enteignet
Während der Übernahme des Landes sollten die Glocken des
gesamten Kreises läuten
Im Kreis Grimma - der damalige Kreis entsprach etwa dem späteren
Muldentalkreis - wurden 70 Güter mit insgesamt 22 246,08 Hektar Grund
und Boden enteignet. Die Fläche gliedert sich folgendermaßen
auf: 14 110,54 Hektar Feld, 6184,41 Hektar Wald, 1026,13 Hektar sonstige
Fläche (Hoffläche, Unland) und 925 Hektar für die Rote Armee.
Die zur Verfügung stehenden 14110,54 Hektar Feld und 2220 Hektar Wald
wurden an 256 landarme Bauern, 1029 Landarbeiter, 541 Umsiedler und 2281
Arbeiter aufgeteilt.
Von dem lebenden und toten Inventar der enteigneten Betriebe erhielten
die Neubauern unter anderem 347 Pferde und 1499 Kühe und des weiteren
576 Pflüge. Die größeren Maschinen, so 105 Traktoren und
66 Dreschmaschinen, erhielt das Komitee der gegenseitigen Bauernhilfe.
Dieses Komitee war der Vorläufer der Maschinenausleihstationen, später
Maschinentraktorenstationen. Die Kreisbodenkommission Grimma ordnete an,
dass am Sonntag, dem 14. Oktober 1945, 14 Uhr, an die landlosen und landarmen
Bauern in einem feierlichen Akt der Boden zu übergeben ist.
Es sollte alles festlich hergerichtet werden, Musik und Gesang waren
erwünscht, Kinderbelustigung und Dorftanz waren angesagt. Ein Kleinbauer
sollte sprechen, während der Übernahme sollten die Glocken des
gesamten Kreises läuten. In Altenhain sprachen der Vertreter der Bezirksleitung
der KPD Grimma Genosse Liebing und der Bürgermeister Kurt Gey (gleichfalls
KPD) von der Freitreppe des Schlosses zu den Neubauern und Siedlern.
Der Kinderchor und die Akkordeongruppe sorgten für die musikalische
Ausgestaltung der Feier. Ein von der Gemeinde besorgter Imbiss vereinte
alle zum frohen Mahl. Abends fanden sich Alt und Jung zum Tanz im Gasthof
Schneiderheinze ein. Alle waren guter Dinge. Wer dachte da wohl an das
Leid der Familie des enteigneten Rittergutsbesitzers.
Die Bodenreform in allen Besatzungszonen
| Sowjetisch besetzte Zone (SBZ) | Amerikanisch besetzte Zone (ABZ) |
| 3,3 Millionen Hektar enteignete
Gesamtfläche. Davon 2,2 Millionen Hektar an 560 000 Bewerber verteilt. |
Zehn bis 90 Prozent der 100 Hektar
übersteigenden Flächen (rund 25000 Hektar) wurden gegen Entschädigung enteignet, konnten aber durch die alten Besitzer wieder gepachtet werden. |
| Britisch besetzte Zone (BBZ) | Französisch besetzte Zone (FBZ) |
| Kaum Enteignungen, sehr bescheidene Siedlungstätigkeit
|
Es blieb den Landesregierungen
überlassen, Betriebe über 150 Hektar zu enteignen (was selten angewendet wurde), sehr bescheidene Siedlungstätigkeit. |
Viele Altenhainer bewarben sich
"Kollektive Bewirtschaftung ist Sabotage an der Bodenreform"
In Altenhain stand das Rittergut - Besitzer Dietrich von Gontard -
mit einer Gesamtfläche von 575 Hektar - davon 312 Hektar Ackerland,
72 Hektar Grünland und 171 Hektar Wald - zur Verfügung. Binnen
einer kurzen Frist hatten sich interessierte Bürger im Gemeindeamt
zu melden. Davon wurde reichlich Gebrauch gemacht, der Not gehorchend,
ohne moralische Bedenken, bewarben sich viele Altenhainer um eine Neubauernstelle
beziehungsweise ein Stück Land. Sachkenntnisse bezüglich der
ordnungsgemäßen Bewirtschaftung von Betrieb oder Parzelle forderte
man nicht.
Dies führte in den späteren Jahren zu geringen Erträgen
und zu häufigen Wechseln der Bauernstellen. Eine Versammlung von Altenhainer
landlosen und landarmen Bauern sowie Umsiedlern - andere Personenkreise
waren nicht zugelassen - wählte die Ortsbodenkommission. Sie bestand
aus Josef Sedlaczek (landarmer Bauer), Georg Reinicke (Steinbrucharbeiter),
Bruno Leipe (Umsiedler aus Schlesien), seit 27. Februar 1945 in Altenhain,
und Max Peter (Steinbrucharbeiter), KPD und damit Vorsitzender der Kommission.
Er war fachlich total überfordert.
Man bezeichnete ihn als "Parteisekretär". Er begnügte sich
mit der Unterschriftsleistung. Die Hauptlast der Arbeiten lag auf den Schultern
von Bruno Leipe. Außerhalb der Kommission übernahmen Willi Treller
und Paul Westphal die Aufteilung des Waldes. Das Rittergut wurde ausschließlich
an Bürger dieses Dorfes aufgeteilt, ausgenommen einer Fläche
an der Gemarkungsgrenze, die Leipziger Siedler erhielten (heute Verein
Sonnenblick). 42 Neubauern erhielten je 6,18 Hektar Ackerland, 0,82 Hektar
Grünland, 20 Hektar Wald und etwa 60 Siedler bis 0,5 Hektar Boden.
Die neuen Eigentümer erhielten den Boden zwar schuldenfrei, hatten
aber eine bestimmte Summe zu entrichten. Sie betrug in Sachsen entsprechend
dem Wert einer Jahresernte Roggen (1000 bis 2000 Kilogramm pro Hektar je
nach Bodenart). Der Betrag musste in einem Zeitraum von zehn bis 20 Jahren
bezahlt werden. Das erste Jahr arbeiteten die Neubauern genossenschaftlich.
Auch in anderen Gegenden wünschte man diese Wirtschaftsform. Es wurde
nicht gestattet. Auszug aus einem Kongressprotokoll: "Jeder Versuch kollektiver
oder genossenschaftlicher Bewirtschaftung ist eine Sabotage an der Bodenreform."
Sieben Jahre später drängte man die Neubauern in die LPG.
|
Ab 1952 erfolgte der Zusammenschluss in LPGs. |
der Kommunistischen Partei Deutschlands im Jahre 1945. |
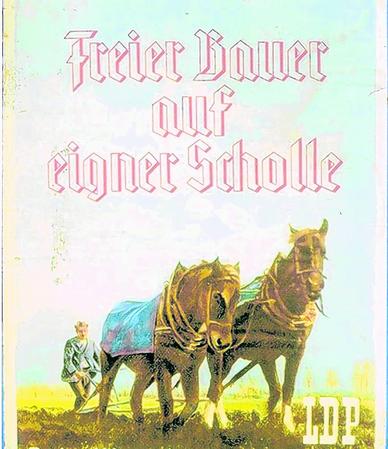 |
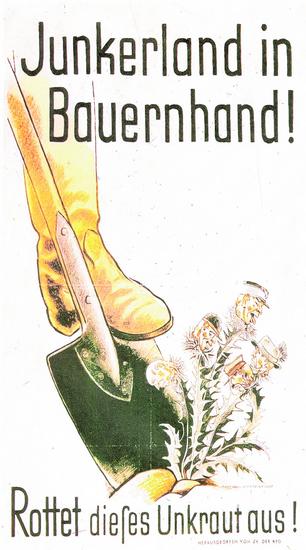 |
Jeder neue Landbesitzer durch die Bodenreform erhielt eine solche Urkunde.
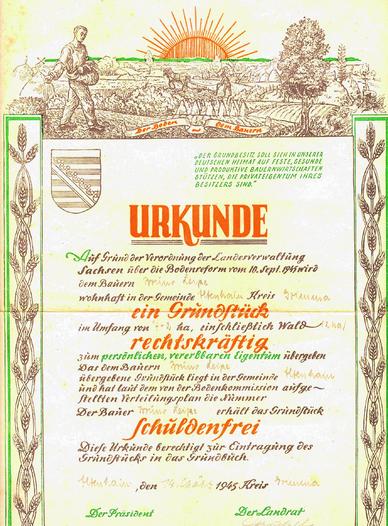
Texte und Repros: Gerd Misselwitz erschienen in LVZ Muldental 20. September
2010