
Siegfried August Mahlmann (1771 - 1826) Bild rechts Das Herrenhaus Obernitzschka oder besser:
|
 |
vor 180 Jahren erwarb der Dichter Siegfried August Mahlmann
das Gut Obernitzschka
von Dagmar Schäfer unter: Literatur
vom Schaufenster am Wochenende 06.08.1994
eine Beilage der Muldental Zeitung (1991 - 1998)
Hier soll ein Dichter gelebt haben? Der Besucher des ehemaligen Rittergutes
Obernitzschka oder besser dessen, was davon übrigblieb, kann es nicht
glauben: Arg wenig Lyrisches liegt in der Luft und vor seinen Augen. Vom
Herrenhaus, einem Barockbau aus dem Jahr 1704, 1947 als Steinbruch zur
Errichtung von Neubauerngehöften freigegeben, blieben gerade mal ein
paar Grundmauern und verstreute Reste abgebrochenen Gesteins. Das barocke
Wohnstallhaus, noch immer zur Tierhaltung genutzt und sehr sanierungsbedürftig,
verbreitet Stimmung vergehender Schönheit, die keiner wahrnimmt, begreift
oder achte! Der Gutspark liegt verwahrlost, kaum, daß man ihn erahnt
zwischen prächtigen Bäumen verstecken sich Mauerreste, die den
Blick über die weite, reizvolle Muldenlandschaft freigeben. Neben
Gesteinsquadern winden sich die Überbleibsel einer Treppe: Wohin führt
sie? Auf einem Sockel reckt sich ein Holunderbusch, zu Füßen
umspült von äuberlich gezogenen Kartoffelfurchen - stand hier
einst die Gedenktafel für Siegfried August Mahlmann, den sächsischen
Dichter und Publizisten, Freimaurer und Gelehrten?
Im Festungsgefängnis Erfurt
Das Jahr 1813 setzt Mahlmann hart zu. Am 31. März rücken
russische Truppen in Leipzig ein, stellen die von Mahlmann geleitete "Leipziger
Zeitung" sofort unter Zensur. Mahlmann wird zum kaiserlich - russischen
Adjutanten von Orloff beschieden, der ihm eröffnet, daß die
Zeitung von nun ab unter seinen Befehlen stehe. Mahlmann ist nicht unglücklich
darüber, daß die französische Herrschafft über die
Zeitung vorbei zu sein scheint. Im April bringt die „Leipziger Zeitung"
fast täglich Aufrufe an die sächsische Bevölkerung, sich
den Verbündeten anzuschließen. Doch dann wendet sich das Blatt:
Napoleon siegt Anfang Mai bei Lützen, die Franzosen ziehen wieder
in Leipzig ein. Eilig verläßt Mahlmann die Stadt, wagt sich
erst zurück, als der sächsische König wieder in Dresden
eintrifft. Zwar ist er den Franzosen ganz gefügig, diese aber warten
nur darauf, ihm seinen Abfall zu vergelten. Eine harmlose, nebensächliche
Anzeige dient als Vorwand, Mahlmann antifranzösische Gesinnung vorzuwerfen.
Am 24. Juni 1813 wird er ins Festungsgefängnis Erfurt abgeführt.
„Frech, mit Desopten Gewalt, ohn' Untersuchung und Recht", dichtet er später.
An die Kerkerwände findet er einige seiner Gedichte geschrieben und
holt sich neuen Mut. Als man ihm aber mitteilt, daß er bis zum Ende
des Krieges seiner Freiheit beraubt bleiben soll, ist er dieser Last nicht
gewachsen. Völlig zusammengebrochen schreibt er: „Meine Gesundheit
erliegt, ich fühle mich krank der tiefste Kummer und Schmerz verzehrt
meine Kräfte ... Nur baldige Hilfe kann mich retten... "Mahlmanns
Frau gelingt es, am sächsischen Hof die Freilassung zu erwirken, am
2. Juli öffnet ihm der Kommandant das Gefängnis, Mahlmann kehrt
nach Leipzig zurück. Doch seine Lage bleibt unsicher. Von nun an überwacht
ein französischer Agent, was in der „Leipziger Zeitung" erscheint
Die Schlacht bei Leipzig ändert wiederum altes: Die russisch - preußischen
Zensoren kehren zurück. Doch Mahlmann schwelgt viel zu sehr in der
Freude über Napoleons Niederlage, um den neuen Druck so schnell zu
spüren. Doch Mahlmanns Freude währt nicht lange. 1814 beginnt
der Wiener Kongreß, bald schon kommt die Nachricht, Sachsen werde
geteilt. Mahlmann ist empört und wie vernichtet. Den jährlichen
Festversammlungen zum Jahrestag der Völkerschlacht bleibt er von nun
an fern. Wieder einmal sind seine Hoffnungen zerstört. Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit - Mahlmann sieht sie ins Grab gesunken:
„Selig die Toten! Sie ruhen und rasten/Von quälenden Sorgen, von drückenden lasten,/Vom Joche der Welt und der Tyrannei/Das Grab, das Grab macht allein uns Frei. Ueber der Erde, da wallten die Sorgen, Im Schoße der Mutter ist jeder geborgen“!/O Nacht des Totes, du bettest weich!/Das Grab, das Grab macht allein uns gleich.“
Sehnsucht nach ländlicher Ruhe
Als politischer Publizist in aufgeregten Zeilen stets an gefährdeter
Stelle stehend, müde und enttäuscht vom ewigen Auf und Ab der
politischen Ereignisse, erschöpft vom ständigen Zwang, sich den
Lebensunterhalt erschreiben zu müssen, sehnt sich Mahlmann nach Ruhe,
nach ländlicher Abgeschiedenheit Leipzig, die Stadt die mit seinem
Schaffen untrennbar verknüpft ist, hat er satt. Harte Worte findet
er Hier brenne kein anderer Altar als der des Eigennutzes, hier herrsche
kein anderer Gott als der der Diebe und Kaufleute. Stets hat Mahlmann in
Leipzig zwischen Hoffnung und Enttäuschung gelebt. Hierher kam er
als 18jähriger, froh, der engherzigen
Internatserziehung in der Grimmaer Fürstenschule entronnen zu
sein. hier begeisterte er sich als Student der Rechtswissenschaften voller
Leidenschaft und Freiheitsdurst für die französische Revolution.
Hier in Leipzig erhob er, der Bürgerliche, seine Stimme gegen das
leichtfertige Leben an den Höfen, gegen die konservativ- bürokratische
Selbstverwaltung, ja gegen die Fürsten und die Monarchie selbst Noch
als herzoglich – gothaischer und königlich - sächsischer Hofrat
verhöhnte Mahlmann mit Bürgerstolz Adel und Hofleute. Frank und
frei sagte er seine Meinung - als freisinniger, demokratisch fühlender
Mann. Hier in Leipzig begrüßte er den Einmarsch der französischen
Truppen, hier bejubelte er 1806 Napoleon als ersehnten Friedensbringer
und Erfüller des Humanitätsideals. Nach dem Friedensvertrag von
Tilsit, der Sachsen zum Königreich erhob und mit dem Herzogtum Warschau
verband, Preußen aber seiner Vormachtsstellung beraubte, dichtete
Mahlmann begeistert:
„Da kam der Held, vor dem Sich Völker beugen,/ Dem Gott Europas Zepter gab,/ Er kam und sah – und alle Donner schwiegen/Und aller Völker Macht zersteubt!/ Der Sieg ist ihm getreu, der seine Bahnen brach,/Vor ihm geht Schrecken her, doch Großmut folgt ihm nach“
Hier in Leipzig fühlte er sich als sächsischer Weltbürger, leitete in diesem Sinne zunächst die „Zeitung für die elegante Welt", später die „Leipziger Zeitung". Doch dann setzte seine Enttäuschung ein: Mahlmann spürte die französische Despotie.
Letztes Ziel: Obernitzschka
Leipzig, die Stätte seiner Hoffnungen und Enttäuschungen,
will Mahlmann nun verlassen. 1814 kauft er das Gut Obernitzschka, malerisch
an der Mulde zwischen Grimma und Wurzen gelegen. 43 Jahre ist er erst alt,
und doch neigt sich sein Leben bereits. Noch einmal setzt er sich ein Ziel,
verwaltet mit Umsicht und Sorgfalt sein Gut, treibt mit geradezu jugendlichem
Eifer Naturkunde, Physik, Chemie und Astronomie. Noch einmal hört
er Vorlesungen an der Leipziger Universität, tragt eine wertvolle
Sammlung astronomischer und physikalischer Instrumente zusammen. Seine
literarische Tätigkeit ruht nun fast vollständig, nach Leipzig
kommt er kaum noch. Er sucht seine Ruhe nur noch in den Wissenschaften.
Aber er findet sie nicht Sein athletischer Körper, scheinbar wie geschaffen,
jede Last spielend zu tragen, beginnt er zu kränkeln. Die Folgen eines
Sturzes vom Pferd beschleunigen den Verfall. Als ob Mahlmann seinen nahen
Tod ahnt, gibt er 1825 seine
gesammelten Gedichte heraus. Am 17.Dezember 1826 stirbt er, erst 55jährig
und wird auf dem Alten Johannisfriedhof in Leipzig begraben
Wer kennt Mahlmann?
Freilich, Überragendes hat er nicht geschaffen. Als Typus eines
gebildeten Sachsen an der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, als Kosmopolit
und Kriegsgegner aber hat er wohl Erinnerung verdient, ganz im Sinne seiner
eigenen Worte: „Wer geendet im edlen Bestreben, verdient im Herzen der
Nachwelt zu leben!" In Nitzschka ist von dieser Erinnerung heute nichts
zu spüren. Wer im Gut zwischen Dunghaufen, Schrottplatz und Unkrautgarten
wandelt, der begreift: Nicht nur fehlende Mittel bedrohen Kultur - Vergessen
und Gleichgültigkeit mindestens ebenso.

Siegfried August Mahlmann (1771 - 1826) Bild rechts Das Herrenhaus Obernitzschka oder besser:
|
 |
August Mahlmann (1771 – 1826)
ein Patriot des Wurzener Landes, lebte lange Jahre
in Nitzschka. Er war ein mutiger Kämpfer gegen die französischen
Unterdrücker. Als Herausgeber und Redakteur des „Intelligenzblattes
der Zeitung für die elegante Welt" brachte er offen und versteckt
seinen Widerwillen gegen die Franzosen zum Ausdruck. Im Jahre 1813 wurde
er dafür einmal für kurze Zeit in Gefängnishaft genommen
(siehe LVZ [Kreis Wurzen] vom 6. Juli 1956).
Der Ausgabe vom 6. Januar 1810 seiner Schrift entnehmen
wir nachfolgenden interessanten Beitrag, worin Mahlmann die „Zuckerfabrikation
aus Runkelrüben" aufs stärkste befürwortet, um dadurch den
verteuerten Zuckerimport einzuschränken.
„An Patrioten!
Bei dem immer höher steigenden Preise des westindischen
Zuckers, ist es Sache des Patrioten, Staats- und Landwirths, alles zu thun,
um eine Unternehmung zu begünstigen, welche ganz dazu geeignet ist,
durch Ihre großen Vorteile, die darauf gewandten Kosten und Bemühungen
zu belohnen. Dieß ist die europäische Zuckerfabrikation aus
Runkelrüben, welche in dem kürzlich erschienenen Werke: „Die
europäische Zuckerfabrikation aus Runkelrüben, in Verbindung
mit der des Branteweins, Rum's, Essigs, Kaffee’s u.s.w. aus ihren Abfällen
besichrieben und durch Kupser erläutert von F. Achard, Direktor der
Berl. Akademie, 3 Theile in gr. 4to. Leipzig, bei J. C. Hinrichs, 6 Thaler",
so vollständig als gründlich beschrieben, und durch zehn große
Fol. Kupfertafeln erläutert sind, daß man weiter nichts wünschen
darf, als eine durchgängige Beherzigung der Wichtigkeit dieses Werkes,
und Nachahmung derer, welche nach Anleitung desselben die Zuckerfabrikation
aus Runkelrüben mit dem besten Erfolg im Großem eingeführt
haben, als der Freiherr von Lorenz bei Wurzen, und der Major von Koppy
auf seinen Gütern in Schlesien, welcher über 20 000 Centner fabricieren
läßt; wo sich aus den Versuchen ergibt, daß der feinste
Zucker zu allen Zeiten das Pfund um 6 Gr. gegeben werden, und folglich
mit den westindischen, wenn er auch noch so wohlfeil ist, Preis halten
kann. Die Abfälle sind überdies noch zur Fabrikation des Rums,
Branteweins, Essigs, so wie zur Viehzucht, Dünger u.s.w. vortrefflich
zu benutzen. Proben von Runkelrüben-Roh-Candis und raffinirten Zucker,
ingleichen Syrup, Rum, Essig, Tabak, Caffee u.s.w. sind bei dem Verleger
des Werks J. C. Hinrichs in Leipzig, in Augenschein zu nehmen, und werden
bei direkter Verwendung mit 6 Thaler baar mit dem Werke zugleich verabfolgt,.
Man fordert daher alle Patrioten zur Unterstützung dieser Unternehmung
auf, und gibt ihnen zu bedenken, welche Summe durch die Kultur dieses Produktes
dem Lande erspart, und zum anderweitigen Besten verwendet werden können!"
aus Rundblick 1. und 15. August 1956 Nr.: 15/16 3. Jahrgang Doppelheft
Siegfried August Mahlmann
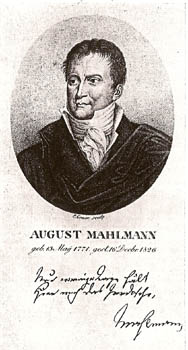 |
Heute kann ein Bild des Schriftstellers gebracht werden. Bilder von Mahlmann sind selten. Das hier gezeigte findet sich als Stahlstich im „Neuer Nekrolog der Deutschen", IV. Jahrgang, 1826, l. Teil, Ilmenau, Bernhard Fr. Voigt, 1828. Die Wiedergabe zeigt die Originalgröße des Stichs. Mahlmann war Jurist. Nach längeren Reisen in seine Vaterstadt zurückgekehrt, übernahm er von 1805 bis 1816 die Redaktion der „Zeitung für die elegante Welt". 1810 erhielt er die Pacht und Administration der „Leipziger Zeitung", die er 1818 aufgab, um sich auf seine ländlichen Besitzungen zurückzuziehen. Er verfaßte „Erzählungen und Märchen", auch geistliche Lieder. Zu seinen dramatischen Dichtungen gehörten die Parodie „Herodes von Bethlehem" ferner die Lustspiele „Der Geburtstag" und die „Liebesproben". Viele seiner Lieder sind vertont worden, so auch das „Abendlied an Minna", in dem es heißt: „Wie hängt die Nacht voll Welten! Wie glänzt der Abendstern,
Er blickt mit Vaterliebe aus diesem Sonnenmeer,
und so weiter. |

Foto aufgenommen am 16. Mai 2008 auf dem alten Johannisfriedhof
in Leipzig
das Grab befindet sich an der Rückwand zur Gutenbergschule
und HTWK Leipzig
der alte Johannisfriedhof befindet sich hinter dem
Grassimuseum
und dem Straßendreieck Prager Straße;
Täubchenweg; Gutenbergplatz
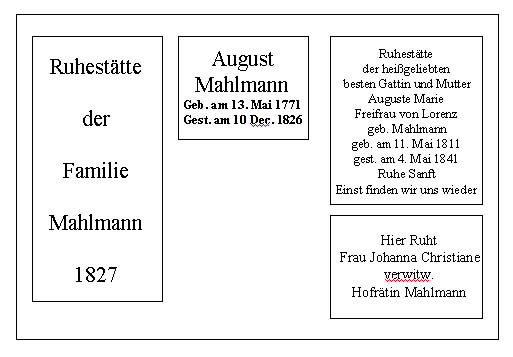
Garbinnenschrift
Siegfried August Mahlmann
Schriftsteller, Verleger.
1793 Hofmeister in Riga
1805 Redakteur der "Zeitung für die Elegante
Welt"
1810 Leiter "Der Leipziger Zeitung"
hatte das Schloss Nitzschka von 1814 - 1826 seinem Todesjahr inne
durch Verheiratung seiner Tochter
ging es an Baron von Lorenz auf Burkartshain über
bis 1858
(siehe Grabinnenschrift)
Sonstiges:
um 1853 war Wilhelm Knauf (1795 - 1860) Förster
auf dem Rittergut Mahlmann in Obernitzschka
Quelle: Familienverband Knauff,f,ft e,V.
siehe auch unter Personen Mahlmann